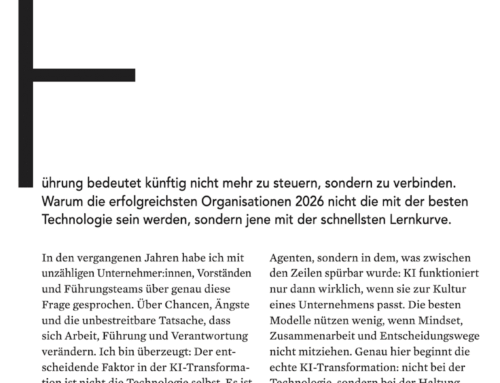Generative KI als strategisches Werkzeug: Weg von der Spielwiese, rein in die Wertschöpfung
Generative künstliche Intelligenz ist branchenübergreifend in vielen Unternehmen mittlerweile angekommen – zumindest technisch. Es gibt Pilotprojekte, interne Experimente, ChatGPT-Sandboxen, erste Automatisierungen. Doch wenn man genauer hinschaut, zeigt sich: Viele Organisationen bleiben in der Spielwiese stecken. Generative KI wird ausprobiert, aber selten entlang der Wertschöpfungskette wirklich integriert. Eine Frage, die uns im Beratungsalltag immer wieder begegnet und bei denen wir in unseren Projekten immer wieder Impulse liefern, lautet: Wie wird aus Experimentierfreude echte Wirkung? Aus diesem Grund führen wir als doubleYUU für und mit unseren Kunden viele verschiedene Veranstaltungsformate durch: von auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenen Hackathons, über Bootcamps, KI-Werkstätten oder Open Spaces. Wenn Sie mehr über derartige Möglichkeiten erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne.
Vom Experiment zur Strategie: oftmals ein steiniger Weg
Das eigentliche Problem liegt selten in der Technologie. Die generativen KI-Tools für die meisten Anwendung sind verfügbar und das Know-how lässt sich ebenfalls aufbauen. Was fehlt, ist oft ein klarer strategischer Rahmen: eine Vorstellung davon, wo KI tatsächlich Mehrwert stiften soll – und wie sie in die Unternehmensziele einzahlt.
Viele Unternehmen starten mit „Proof of Concepts“, ohne vorher zu klären, welchen geschäftlichen Nutzen sie eigentlich erzeugen wollen. Das Ergebnis: spannende Prototypen ohne oder nur mit stark begrenzter Einsatzfähigkeit. Der entscheidende Schritt ist, KI nicht als Selbstzweck, sondern als Instrument strategischer Wertschöpfung zu begreifen – vergleichbar mit einem Werkzeug, das erst dann nützlich ist, wenn man weiß, wofür man es einsetzt.
Bevor ein Unternehmen in das nächste KI-Projekt investiert, helfen daher drei – auf den ersten Block – einfache, aber entscheidende Fragen:
1. „Welches Problem wollen wir wirklich lösen?“
KI ist kein Selbstläufer. Sie entfaltet ihre Kraft, wenn sie ein konkretes Geschäftsproblem adressiert – zum Beispiel ineffiziente Prozesse, ungenutzte Datenpotenziale oder Entscheidungslücken im Management.
2. „Wie messen wir unseren Erfolg?“
Ohne klare Erfolgsindikatoren wird jedes Projekt zum Bauchgefühl. Ob Effizienzgewinne, Umsatzsteigerung oder Mitarbeiterentlastung – Zielgrößen müssen von Anfang an definiert und verfolgt werden.
3. „Wer übernimmt eigentlich die Verantwortung?“
KI funktioniert nicht in der Linie, sondern in der Verantwortung. Es braucht Ownership – Menschen, die sich zuständig fühlen, lernen, anpassen und iterieren.
Von der Idee zur Wirkung: Drei konkrete Anwendungsfelder
In der Praxis sehen wir momentan vor allem drei Felder, in denen KI bereits heute spürbare Wirkung entfaltet – wenn sie strategisch richtig eingebettet ist:
- Entscheidungsunterstützung für Führungskräfte: KI kann Datenfluten strukturieren und Muster sichtbar machen, die Menschen übersehen. Führung wird dadurch nicht ersetzt, sondern gestärkt. Im Alltag bedeutet das: schnellere, fundiertere Entscheidungen bei weniger Stress – weil Routineanalysen und Szenariovergleiche stark automatisiert ablaufen können.
- Kundenorientierte Prozesse und Services: Ob personalisierte Empfehlungen, intelligente Servicebots oder vorausschauende Wartung – Unternehmen, die KI konsequent entlang der Customer Journey einsetzen, schaffen messbare Kundenerlebnisse. Entscheidend ist, dass Technologie immer aus Kundensicht gedacht wird – nicht aus Prozesssicht (Stichwort „Working backwards“).
- Entwicklung hin zu Tiny Teams: Ein drittes Wirkungsfeld generativer KI kann der strukturelle Wandel von Organisationseinheiten sein – hin zu sogenannten Tiny Teams. Durch den gezielten Einsatz von KI können kleine, hochfokussierte Teams Aufgaben übernehmen, für die früher komplette Abteilungen notwendig waren. KI übernimmt dabei nicht nur operative Arbeit, sondern erweitert die Perspektiven, Rollen und Fähigkeiten der Teammitglieder.
In der Praxis bedeutet das: Ein Team von drei bis fünf Personen kann heute strategische, kreative und operative Aufgaben gleichzeitig abbilden – unterstützt durch KI als Sparringspartner, Analyst, Ideengeber oder Umsetzungshelfer. Unterschiedliche Blickwinkel, die früher durch große, heterogene Teams erzeugt wurden, lassen sich durch spezialisierte KI-Agenten ergänzen: vom Marktanalysten über den Strategen bis hin zum operativen Umsetzer. In Kombination mit agilen Zielsystemen wie OKRs entfalten Tiny Teams ihr volles Potenzial. Ziele werden klarer definiert, Fortschritte sind transparenter messbar, und KI kann als kontinuierliches Feedbacksystem dienen – etwa durch die Analyse von Zielerreichung, Priorisierung von Initiativen oder Simulation alternativer Handlungsoptionen. So entsteht ein Organisationsmodell, das Geschwindigkeit, Fokus und Lernfähigkeit verbindet.
Gleichzeitig stellt dieses Modell etablierte Hierarchien und Machtstrukturen infrage. Weniger Abstimmungsschleifen, flachere Strukturen und höhere Eigenverantwortung sind nicht in jeder Organisation politisch oder kulturell sofort gewollt. Doch genau hier liegt die strategische Chance: Unternehmen, die den Mut haben, Verantwortung zu dezentralisieren und Teams echte Entscheidungsspielräume zu geben, schaffen sich einen strukturellen Vorteil in einer zunehmend dynamischen, KI-gestützten Arbeitswelt.
Tiny Teams sind somit weniger ein Effizienzmodell als vielmehr ein neues Führungsprinzip: Sie verlangen Vertrauen statt Kontrolle, Klarheit statt Bürokratie und Wirkung statt Status – und machen Organisationen nicht größer, sondern wirksamer.
Führung neu denken
Wie wir unter anderem in unserem neuen Whitepaper „Mindset Matters: Der Schlüssel für erfolgreiche KI-Integration in Unternehmen“ erklären ist die Einführung von KI ist weniger eine technische als eine kulturelle Herausforderung. Führung muss lernen, loszulassen – und gleichzeitig Orientierung zu geben. Das bedeutet: keine Angst vor Kontrollverlust, sondern Vertrauen in ein System, das Lernen ermöglicht. Unternehmen, die KI erfolgreich integrieren, haben verstanden: Wirkung entsteht meist nur dort, wo Technologie auf Haltung trifft.
Der Weg von der Spielwiese rein ins „Doing“
Der Übergang von Experimenten zu echter Wirkung gelingt nur, wenn drei Dinge zusammenkommen: Erstens braucht es eine strategische Verankerung – KI darf kein Side-Project im Innovationslabor sein, sondern muss Teil der Unternehmensstrategie werden. Zweitens braucht es kulturelle Reife – ohne eine offene, lernorientierte Haltung bleibt jede Technologie oberflächlich. Und drittens braucht es operative Klarheit – Verantwortlichkeiten, Prozesse und Messgrößen müssen definiert sein, bevor der Rollout startet. Nur wenn Strategie, Kultur und Umsetzung zusammenspielen, entsteht aus Technologie echte Wirkung.
KI ist kein Allheilmittel. Aber sie ist schon heute ein mächtiges Werkzeug, wenn man sie gezielt einsetzt. Unternehmen, die heute lernen, sie strategisch zu nutzen, schaffen sich morgen einen echten Vorsprung – in Geschwindigkeit, Qualität und Entscheidungsfähigkeit.
Wer mehr zum Thema KI erfahren möchte: Unser Whitepaper „Mindset Matters: Der Schlüssel zu erfolgreicher KI-Einführung in Unternehmen“ steht hier zur kostenlos zur Verfügung. Unser Whitepaper „Die OKR-Methode: Mit OKRs erfolgreiche Ziele (um)setzen“ steht hier zum Download bereit.
Interesse an Entlastung? Dann freuen wir uns auf Eure Kontaktaufnahme.