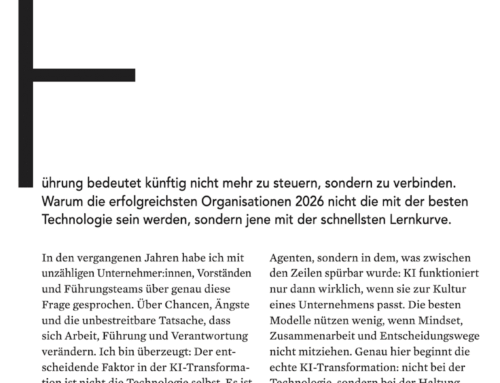Working Backwards – Wie radikale Kundenzentrierung Innovation wirklich vorantreibt
Viele Unternehmen behaupten gerne von sich, sie seien kundenzentriert. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell: Oft bleibt es lediglich bei dieser Behauptung. In Meetings werden Kundinnen und Kunden als Zielgruppe beschrieben, vermeintliche Personas werden mit hohem Aufwand entwickelt, alles sorgfältigst in Strategiepapiere eingetragen und in Präsentationen veranschaulicht – aber in den meisten Organisationen stehen immer noch dominante interne Prozesse, Hierarchien oder technische Machbarkeiten im absoluten Mittelpunkt. Dieses (falsche) Vorgehen begegnet uns immer wieder im Beratungsalltag.
Wirklich kundenzentriert zu denken, bedeutet dabei etwas völlig anderes. Es heißt, vom Kunden aus rückwärts zu denken – nicht von der Organisation aus vorwärts. Und genau hier setzt das Prinzip des „Working Backwards“ an.
Ein Prinzip mit Sprengkraft
Working Backwards stammt ursprünglich aus der Innovationskultur von Amazon und hat dort eine zentrale Bedeutung: Neue Ideen entstehen nicht aus Brainstormings oder Technologie-Hypes, sondern aus konkret beobachteten Kundenproblemen. Der Prozess beginnt mit einer einfachen, aber radikalen Frage: „Was wäre, wenn wir schon das perfekte Produkt für unsere Kunden entwickelt hätten – wie sähe z. B. die entsprechende Pressemitteilung dazu aus?“
Anstatt also sofort ein Team auf die Entwicklung zu setzen, schreiben die Verantwortlichen zunächst eine fiktive Pressemitteilung. Darin steht, was das Produkt oder die Dienstleistung leistet, welchen konkreten Nutzen sie hat und warum sie für Kundinnen und Kunden relevant ist. Diese Pressemitteilung zwingt alle Beteiligten dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Wert, den etwas stiftet – und nicht (!) die Features, die man implementieren möchte.
Was zunächst einfach klingt, ist in der Praxis durchaus anspruchsvoll. Denn es bedeutet, interne Denkmuster zu hinterfragen und zu durchbrechen: Nicht mehr die eigene Abteilung, das Budget oder der Prozess sind der Ausgangspunkt – sondern der Mensch, der am Ende davon profitieren soll.
Vom Kundenproblem zur echten Innovation
Im nächsten Schritt entstehen Use Cases nahe am Kunden, also konkrete Anwendungsszenarien, die zeigen, wie der Kunde mit dem neuen Produkt oder Service interagiert. Diese Use Cases werden so plastisch beschrieben, dass sie im besten Fall Empathie auslösen: Man versteht, warum diese Lösung einen Unterschied macht.
Erst danach werden Features, Funktionen und technische Anforderungen abgeleitet. Jeder Entwicklungsschritt wird wieder überprüft: Entspricht das noch dem ursprünglich definierten Kundennutzen? Oder sind wir bereits wieder in unsere alte Logik zurückgefallen, Dinge zu tun, weil wir sie technisch können – nicht, weil sie jemand braucht?
Diese konsequente Fokussierung sorgt dafür, dass am Ende Produkte und Services entstehen, die nicht nur funktionieren, sondern begeistern.
Warum Working Backwards im KI-Zeitalter unverzichtbar ist
Gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gewinnt dieser Ansatz noch einmal mehr an Bedeutung. Denn KI kann zwar nahezu alles – aber sie sollte nicht alles tun!
Viele Unternehmen tappen aktuell in dieselbe Falle wie bei früheren Technologie-Wellen: Sie führen KI ein, ohne zu wissen, welches Kundenproblem sie damit eigentlich lösen wollen. Das Ergebnis: ungenutzte Tools, überforderte Teams und kein erkennbarer Mehrwert. Working Backwards verhindert genau das. Es sorgt dafür, dass Technologie nicht zum Selbstzweck wird, sondern gezielt eingesetzt wird, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen oder neue Erlebnisse zu schaffen.
Ein gutes Beispiel aus der Praxis: Wenn ein Versicherungsunternehmen KI nutzt, um die Schadensbearbeitung zu beschleunigen, ist das nur dann ein Fortschritt, wenn Kundinnen und Kunden diesen Unterschied tatsächlich spüren – etwa durch schnellere Rückmeldungen, mehr Transparenz oder weniger Papierkram. Wenn sie nichts davon merken, war es keine Innovation, sondern Prozessoptimierung ohne (Außen-)Wirkung.
Customer Obsession – viel mehr als nur ein Buzzword
In der Praxis bedeutet Customer Obsession eine Haltung, die tief in der Organisation verankert werden muss.
Kundenzentrierte Unternehmen stellen Fragen wie:
- „Wie einfach ist es wirklich, mit uns Geschäfte zu machen?“
- „Wie schnell verstehen wir, wenn sich die Lebenswelt unserer Kunden verändert?“
- „Und wie konsequent sind wir darin, alles, was keinen erkennbaren Nutzen stiftet, loszulassen?“
Diese Haltung verlangt Mut. Denn sie bedeutet auch, von liebgewonnenen Routinen Abschied zu nehmen, Projekte zu stoppen, die keinen Unterschied machen, und Entscheidungen nicht aus Macht oder Gewohnheit zu treffen, sondern aus Perspektive des Kunden.
Kundenzentrierung als kulturelle Kompetenz
Working Backwards ist kein Tool, das man einfach einführt. Es ist eine kulturelle Kompetenz.
Sie verändert, wie man denkt, kommuniziert und führt. In Organisationen, die so arbeiten, hört man selten Sätze wie „Das geht bei uns nicht“ oder „Das haben wir schon immer so gemacht“. Stattdessen dominiert eine Haltung, die sagt: „Wie können wir das für den Kunden besser machen?“ Das erfordert Führung, die Empathie und Klarheit verbindet. Führung, die versteht, dass Kundenzentrierung kein Marketing-Thema ist, sondern eine Frage der Organisationslogik.
Unser Fazit
Working Backwards ist die konsequenteste Form von Kundenzentrierung – und im Zeitalter der KI eine unverzichtbare Navigationshilfe. Denn wo technologische Möglichkeiten täglich wachsen, braucht es einen klaren Kompass: den Kunden. Unternehmen, die das verstehen, werden nicht nur bessere Produkte entwickeln, sondern eine Kultur schaffen, in der Innovation kein Zufall mehr ist, sondern eine Folge echter Kundennähe.
Oder, um es auf den Punkt zu bringen: Die Zukunft gehört nicht den Unternehmen mit der besten Technologie – sondern denen mit der tiefsten Empathie ihren Kunden gegenüber.
Wer mehr zum Thema KI erfahren möchte: Unser Whitepaper „Mindset Matters: Der Schlüssel zu erfolgreicher KI-Einführung in Unternehmen“ steht hier zur kostenlos zur Verfügung.
Interesse an Entlastung? Dann freuen wir uns auf Eure Kontaktaufnahme.